Nahrung in der Krise
Was wir aus der Vergangenheit des Agrar- und Ernährungssystems für dessen Zukunft lernen können
am Dienstag, 18.3.2025, Ottensheim




Nahrungsproduktion, erläutert Ernst Langthaler eingangs, ist unmittelbar mit den natürlichen Umweltbedingungen auf der Erde verknüpft.
Die Krisendiagnose:
Die Grenzen der Global- und Biosphäre sind von immanenter Bedeutung. In einigen Bereichen wurden diese Grenzen bereits überschritten (genetische Diversität, Stickstoffbelastung, Phosphor). Einen wesentlichen Anteil trägt dabei die Landwirtschaft, zumindest bestimmte Formen der Bewirtschaftung. Der Verlust der Artenvielfalt ist unübersehbar. Weiters besteht auch eine soziale Krise im Hinblick auf die Welternährung. Die Verteilung zeigt eine Spaltung in „Hungergebiete“ und „Adipositasgebiete“.
Daraus zieht Ernst Langthaler den Schluss: Das Ernährungs- und Agrarsystem sprengt ökologische Grenzen und erzeugt soziale Ungleichheit. Das sind aber nicht bloß fehlerhafte Abweichungen, sondern grundsätzliche Mängel des Systems.
Die Geschichte reicht bis ins Neolithikum – dem Beginn des Ackerbaus – zurück. Doch die bestimmenden Veränderungen beginnen um 1800 herum. Die Bevölkerung wächst um das 6- bis 7-fache. In den vergangenen Jahrhunderten gab es hingegen immer nur Schwankungen um einen bestimmten Punkt, der nicht überschritten wurde. Mit dem Zugriff auf fossile Brennstoffe (Kohle dann Erdöl) konnte die Agrarproduktion um das 10-fache erhöht werden.
Damit beginnt – lt. Langthaler – das britisch-zentrierte Nahrungsregime (1869 – 1929). Verbunden ist damit eine Revolution des Transport- und Kommunikationssektors. Weiters die Besiedelung von Amerika und Australien durch europäische Einwanderer, die auch mittels Sklavenarbeit agrarische Produkte für Europa/Großbritannien herstellen. Aus Afrika und Asien kommen Agrarprodukte aus Plantagenwirtschaft bzw. ebenso Getreide. Gekennzeichnet ist diese Periode durch den Goldstandard und Freihandelsverträge. Eine protektionistische Gegenbewegung formiert sich dabei.


Der Vortragende zeigt am Beispiel der Fleischmetropole Chicago , wie die Fließbandproduktion der Schlachtung und Distribution (nach Europa) erfolgte (ein fabrikmäßiges Kartellsystem).
Nach der Weltwirtschaftskrise (Beginn 1929) und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verortet Langthaler ein US-zentriertes Nahrungsregime (1947 – 1973), das geteilt ist in West (z.B.Marshallplan) und Ost (z.B. COMECON) bzw. Nato und Warschauer Vertragsstaaten („Kalter Krieg“). Im Westen wird eine „Grüne Revolution“ propagiert, die durch Einsatz moderner Technik, neuer Pflanzensorten und verbesserter Anbaumethoden den Ertrag steigert. D.h. es erfolgt nicht primär eine Ausdehnung der Anbaufläche, sondern es wird mehr aus den bestehenden Böden herausgeholt. Die USA sind das Zentrum der Nahrungsmittelproduktion. Ein Teil der Produkte (Futtermittel und Fleisch) gehen in die EWG und nach Japan. Getreide geht in die s.g. Dritte Welt und bewirkt dort Abhängigkeiten. Die Intention ist auch, kommunistischen Bewegungen den Boden zu entziehen. Gekennzeichnet ist diese Periode vom Bretton Woods-System (feste Wechselkurse/Goldbindung, US-Dollar als Leitwährung, IWF und Weltbank) sowie dem GATT (Freihandelsabkommen). Die Nahrungsproduktion wurde jedoch von den liberalen GATT-Bestrebungen weitgehend ausgenommen. In diese Zeit fällt das Aufkommen der neoliberalen Bewegung. Diese Phase ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass eine Abkehr vom solaren Agrarsystem erfolgt (von den natürlichen Kreisläufen bzw. der Kombination von Viehhaltung und Ackerbau). In den USA entstehen Agrarfabriken mit entsprechenden Produktionsmethoden (Mast- und Monokulturen).
Der dritte Bereich – der bis in unsere heutige Zeit reicht – ist das WTO-zentrierte Nahrungsregime (1995-2020). Geprägt vom Neoliberalismus, der nunmehr auch Lebensmittel als Ware – wie jede andere – betrachtet (marktorientiert, Spekulation und profitmaximierend, börsennotiert). Die intensivierte fossilistische Agrarproduktion führt zu Bodenerschöpfung, extremer Vermehrung von Kulturbegleitpflanzen (Unkraut) und Schädlingen sowie zunehmend zu Problemen im Wasserhaushalt. Gülle wird z.B.zum Abfall, obwohl diese in früheren Produktionsweisen immer ein wichtiger Bestandteil im Kreislauf des bäuerlichen Betriebs war. Geprägt ist diese Periode vom Aufstieg von Schwellenländern (China) und der damit verbundenen Ausweitung der Fleischkonsumation. Für die Verfütterung an Tiere ist Soja das wichtigste Futtermittel, das von den USA und zunehmend auch von Brasilien (Rodung des Regenwaldes und Umwandlung der Savannen in großflächige Monokultur-Ackerflächen in Südamerika) erzeugt wird. Asien wir zum Importeur von Soja. USA ist weiterhin Agrarsupermacht. Hier wird vor allem versucht, die auftretenden Probleme durch technologische Verfahren (z.B. genmanipulierte Pflanzen) zu lösen. Im globalen Süden ist eine verstärkte Bewegung der vormals bäuerlichen Bevölkerung vom Land in die Stadt zu beobachten (die aber auch als Migration in andere Staaten und Kontinente sichtbar wird). Das Bretton Woods-Systems bricht zusammen und es etablieren sich flexible Wechselkurse. Von der WTO gibt es das Bestreben, die globale Landwirtschaft zunehmend zu liberalisieren.

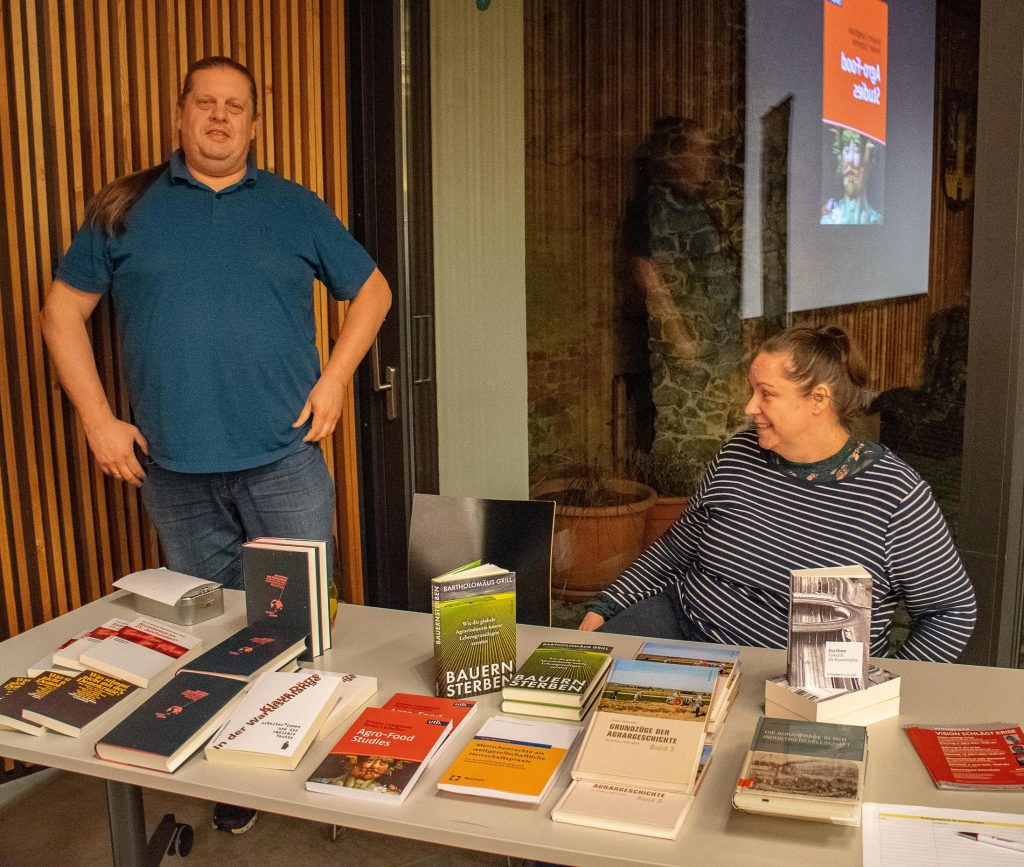
Anhand von Soja in Brasilien veranschaulicht Langthaler, wie man sich dieses Nahrungsregime konkret vorstellen kann, das von den großen s.g. ABCD-Konzernen (Archer Daniels Midland/ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company/LDC) marktbeherrschend dominiert wird. Gegenbewegungen entwickeln sich und fordern Ernährungssouveränität und Entkommodifizierung (bestimmte Güter nicht mehr als Waren zu behandeln).
Abschließend skizziert der Vortragende noch folgende Krisenalternativen:
- – neoliberale Strategie (z.B. WTO): technologische Anpassung der Agrarindustrialisierung
- – reformistische Strategie (z.B. FAO): Nahrungsmittelhilfe und greening
- – progressive Strategie (z.B. Fair Trade) Nischen der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
- – radikale Strategie (z.B. La Via Campesina): Stärkung der Ernährungssouveränität.
Diese verschiedenen Strategien könnten auch ineinander verwoben und wechselseitig sich beeinflussend, zu einer neuen Form führen, die eine große Transformation darstellt.
Als Vision sieht Ernst Langthaler eine nachhaltige Landwirtschafts- und Ernährungsweise, deren Realisierung in folgenden Konstellationen denkbar ist und eine jeweils spezifische Ausprägung erfahren könnte:
- Zivilgesellschaft – Unternehmen: „Grüner Marktfundamentalismus“
- Unternehmen – Staat: „Grüne Marktregulierung“
- Staat – Zivilgesellschaft: „Radikales Postwachstum“
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier.“
Mahatma Gandhi
Text: Harald Wildfellner

